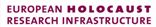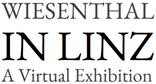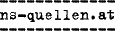Simon Wiesenthal Conferences
Noch in seiner Aufbauphase veranstaltete das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) zwei große internationale Konferenzen: Anfang Juni 2006 die Tagung The Legacy of Simon Wiesenthal for Holocaust Studies im Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), Ende Juni 2007 die Konferenz Arbeit und Vernichtung in der Wiener Arbeiterkammer. Im Oktober 2011 wurde die Reihe unter dem Titel Simon Wiesenthal Conference mit dem Thema Partituren der Erinnerung. Der Holocaust in der Musik an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst fortgesetzt.
Ab 2012 findet die dreitägige, deutsch- und englischsprachige Simon Wiesenthal Conference alljährlich statt. Das thematische Spektrum der Tagungsreihe deckt ebenso wie die Simon Wiesenthal Lectures die gesamte Bandbreite der internationalen Holocaustforschung ab und setzt jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. Die Festlegung der einzelnen Themen erfolgt in Absprache mit dem Internationalen Wissenschaftlichen Beirat. Mithilfe von auf den üblichen akademischen Foren geposteten Call for Papers sollen in erster Linie junge, ambitionierte Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, über gezielte Einladungen für Key-Note-Addresses bzw. zusammenfassende, evaluierende Vorträge aber auch bereits etablierte, international anerkannte Wissenschafterinnen und Wissenschafter angesprochen werden, um die neuesten Ergebnisse der Forschung vor einem interessierten Publikum in Wien zu präsentieren bzw. zu diskutieren.
Die Vorträge der einzelnen Konferenzen werden im Rahmen der VWI-Beiträge zur Holocaustforschung in Englisch oder Deutsch veröffentlicht.
| Simon Wiesenthal Conference | |||
| SWC 2021: Europa Ethnisieren. Hass und Gewalt in Post-Versailles Europa / Ethnicising Europe. Hate and Violence in Post-Versailles Europe | |||
von Dienstag, 6. Juli 2021 - 14:30 Online: https://us02web.zoom.us/j/87583229488
|
|||
Einige der jüngsten historischen Darstellungen interpretieren den Ersten Weltkrieg als eine Serie von Konflikten, die bis Ende der 1920er-Jahre nicht zur Ruhe kamen. Unumstritten bleibt, dass danach die ‚Nation’ zur dominanten Staatsorganisationsform geriet. Aber dieser Übergang verlief weder reibungslos noch geschmeidig. Tatsächlich war er äußerst konfliktbeladen, und Nationalität als wichtigste Ausdrucksform von Loyalität blieb über Jahrzehnte umkämpft. Die Friedensverträge können als Versuch gewertet werden, eine den neuen national(staatlich)en Realitäten entsprechende neue Ordnung zu schaffen. Die konkrete Erfahrung dieser neuen Realitäten bedeutetet den Zwang, sich entscheiden zu müssen. Ob der Friede zu Konflikten führte oder nicht, der Glaube an die allumfassende Herrschaft von Ethnizität ging Hand in Hand mit der Kodifizierung von Mehrheiten und Minderheiten, Nation und Nationalitäten, letztlich Eingrenzung und Ausgrenzung. Es gab keine Grautöne. Früher diffuse Identitäten und Loyalitäten mussten nun eindeutig werden. Und selbst noch nachdem die Friedensverträge bereits in Kraft getreten waren, blieben die neugeschaffenen Staaten zerbrechlich, ihre politische Stabilität wurde meist durch interne Kräfte zerstört, und die neuen Grenzen blieben ebenfalls höchst umstritten. Und schließlich reflektierten viele inmitten aller Unsicherheiten über die jüngste Katastrophe, versuchten einen Sinn in der Kriegserfahrung und der Zukunft zu finden. The collapse of the Central, Eastern, and South-Eastern European empires and the ensuing peace treaties following the First World War produced more than just new borders and new nation states. They also marked a new world order based on the principles of nationhood: The peacemakers of Paris placed the focus on territoriality and citizenship, while insisting on clinging to their overseas territories, denying the populations there the same rights. The impacts of these treaties are still disputed in historiography. Some view the treaties as a failure, as they were unable to ensure reconciliation, their shift from territorial to population policies having paved the way for forced population transfers, ethnic cleansing, and genocide; others highlight the opportunities these treaties provided. Some of the latest historiographical approaches see the First World War as part of a series of conflicts that did not come to an end until the late 1920s. It was only in the course of these civil wars and especially after the ensuing peace that the ‘nation’ became the dominant form of state organisation. Yet this transformation was neither swift nor seamless; in fact, the process was conflicted and nationhood as the most important body of loyalty remained deeply contested for decades. The peace can also be seen as an attempt to bring about an order corresponding to the new realities of nationhood. However, the experience of the new realities often involved forced choices. Whether the peace led to new conflicts or not, the belief in the regime of ethnicity went hand in hand with the legal creation of minorities and majorities, nations and nationalities, inclusion and exclusion: Forging a clear ethnic or national identity allowed no shades of grey. Even after the implementation of the peace treaties was concluded, the new states remained fragile, their political stability was destroyed mostly from within, while the new borders continued to be highly disputed. Amidst all this uncertainty, many reflected on the recent catastrophe, trying to make sense of the war experience and the promoted future. https://us02web.zoom.us/j/87583229488 All times correspond to Central European Time (CET=GMT/UTC+2) Dienstag, 6. Juli 2021 14:30 Begrüßung – Welcome 15:00–17:30 15:00 Alexander Langstaff (New York University) 17:30 Pause – Break 18:00–19:30 Keynote Mittwoch, 7. Juli 2021 10:00–11:30 10:00 Zachary Mazur (College of Europe-Natolin, Warsaw) 11:30 Pause – Break 12:00–14:00 12:00 Andrei Sorescu (Research Institute of the University of Bucharest) 14:00 Pause – Break 15:00–16:30 15:00 Allison Rodriguez (Trinity College, Hartford, Connecticut) Donnerstag, 8. Juli 2021 10:00–11:30 10:00 Tomaž Mesarič (Andrássy Universität Budapest) 11:30 Pause – Break 12:30–15:00 12:30 Alexander Korb (University of Leicester) 15:00 Pause – Break 15:30-16:30 Concept: VWI in cooperation with Raul Cârstocea and Gábor Egry Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung stimmen Sie der Veröffentlichung von Fotos, Video- und Audioaufzeichnungen zu, die im Rahmen dieser entstehen. |
|||