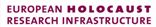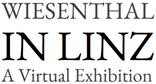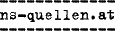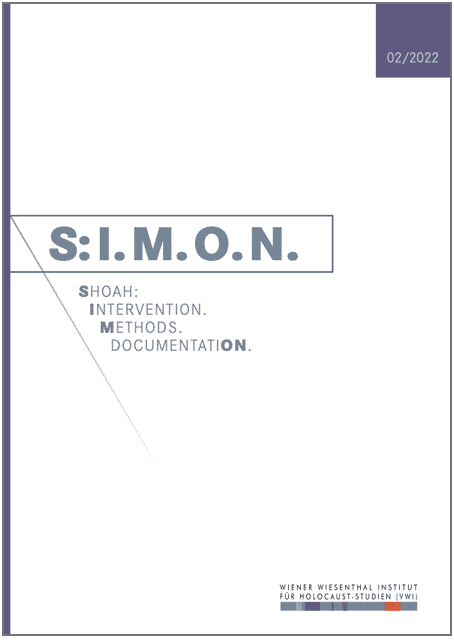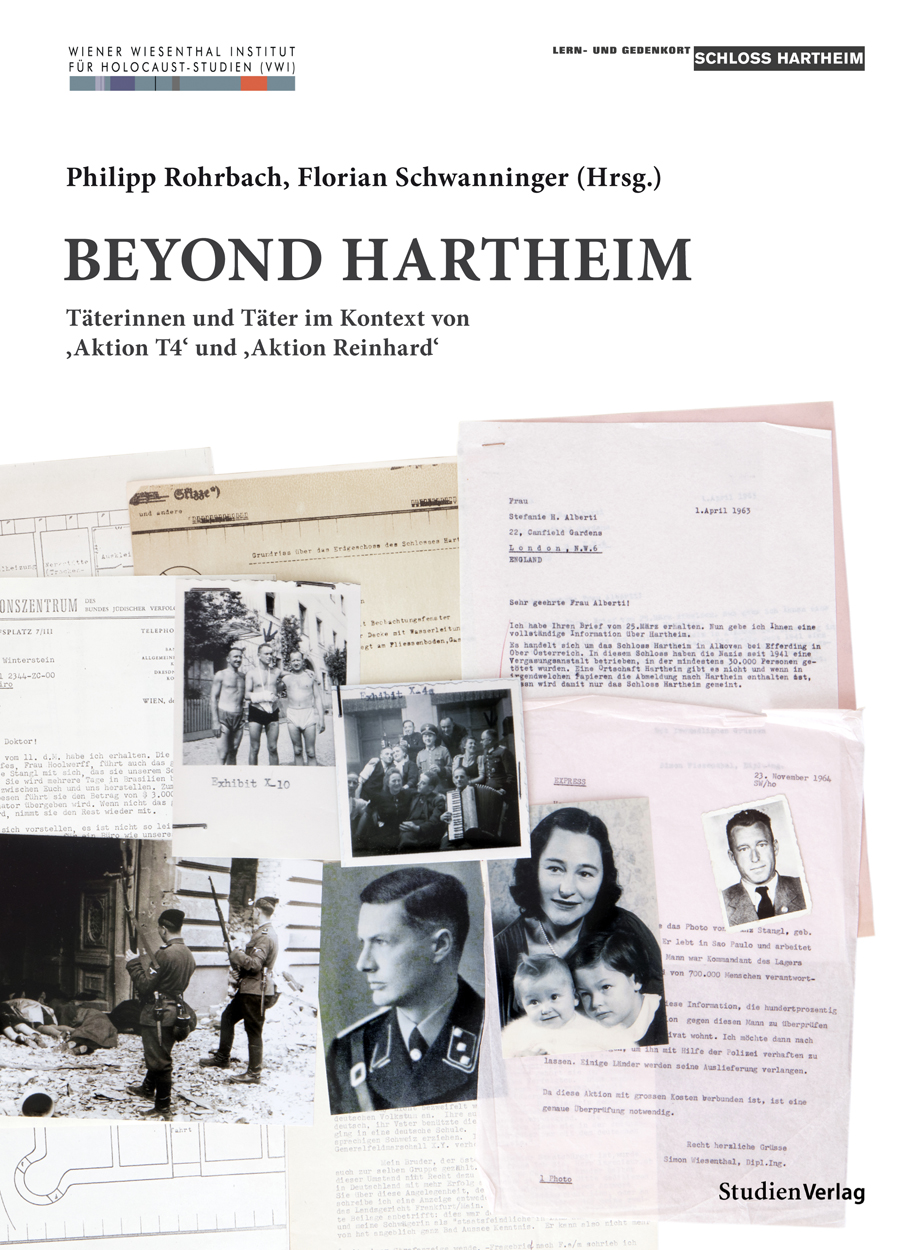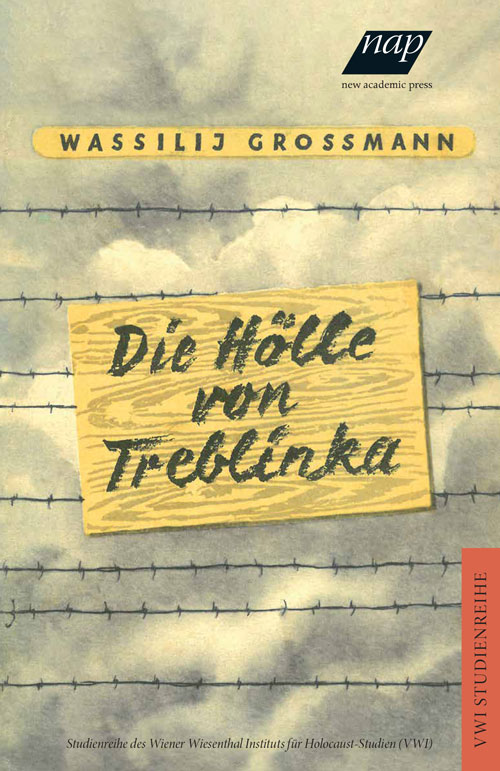News – Veranstaltungen – Calls
| 02. Mai 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureEdyta Gawron: Never Too Late to Remember, Never Too Late for Justice! Holocaust Research and Commemoration in Contemporary PolandIn 1994, Simon Wiesenthal received a doctorate honoris causa from the Jagiellonian University in Krakow for his lifelong quest for justice – half a century after he had been, for a short time, prisoner of the local Nazi Concentration Camp (KL) Plaszow. The 1990s were the decade when t...Weiterlesen... |
| 07. Mai 2024 00:00 - 04. Juni 2024 00:00 WorkshopDealing with Antisemitism in the Past and Present. Scientific Organisations and the State of Research in AustriaThis series of talks, presented by antisemitism experts from different organisations that research antisemitism using a variety of academic approaches, aims to provide a snapshot of historical evolutions, current events, prevalent perceptions and declared (and undeclared) attitudes. I...Weiterlesen... |
| 14. Mai 2024 08:45 - 16. Mai 2024 16:30 TagungQuantifying the Holocaust. Classifying, Counting, Modeling: What Contribution to Holocaust History? About the conference: https://quantiholocaust.sciencesconf.org/ Programme timed on the basis of 15-minute presentations + 15-minute discussions; short breaks and lunches Day 1 Tuesday, 14 May 2024Centre Malher (9 rue Malher 75004 Paris/amphi Dupuis) From 8.45 am: Welcome9.30 am...Weiterlesen... |
| 24. Mai 2024 18:00 InterventionLange Nacht der Forschung 20242024 öffnet das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) in der Langen Nacht der Forschung wieder seine Tore und lädt Interessierte in seine Räumlichkeiten am Rabensteig 3 ein. Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Präsentationen bieten VWI-Team und Gäste Einb...Weiterlesen... |
| 04. Juni 2024 13:00 VWI invites/goes to...Workshop: Social History of the Shoah. Everyday Life, Space and Time VWI invites the Department of Contemporary History, University of Vienna 13:00Hannah Riedler (VWI Junior Fellow)Between Deportation, Forced Labour and Germanisation. The Umwandererzentralstelle in Occupied Poland 1939–1941Commented by Kerstin von Lingen 13:40...Weiterlesen... |
| 13. Juni 2024 18:30 Simon Wiesenthal LectureJack Fairweather: The Trials of Fritz Bauer. How Life as a Gay Jewish Socialist under the Nazis Shaped His Quest for JusticeFritz Bauer’s daring mission to bring Adolf Eichmann and the perpetrators of Auschwitz to justice forced Germany and the world to pay attention to the crimes of the Holocaust. Bauer’s moral courage in speaking out in a society that had not yet come to terms with its past, which he him...Weiterlesen... |
Alexandra Birch
Research Fellow (10/2023 – 08/2024)
GULAGSound: Musik und Mizrachim in Taschkent
 Die Inhaftierung von Künstler:innen und Musiker:innen war ein zentrales Merkmal der kulturellen Verwüstungen des sowjetischen Terrors. Zeitgleich mit dem Holocaust führten Stalinisierung, Terror und Gulag zur gezielten Zerstörung jüdischer Gemeinden von der Ukraine bis Wladiwostok. Um die bestehende Holocaust-Geschichtsschreibung zu erweitern untersucht dieses Projekt zwei klangliche Räume der Internierung: erstens im Rahmen einer Studie über evakuierte Menschen während des Zweiten Weltkriegs und ihre Interaktionen mit Klang während des Transports; zweitens im Rahmen einer Lokalstudie über Taschkent, die den jüdischen Transit nach Birobidzhan in der Vorkriegszeit und die Interaktionen der evakuierten Jüdinnen und Juden mit den bucharischen jüdischen Gemeinden in Zentralasien in Augenschein nimmt.
Die Inhaftierung von Künstler:innen und Musiker:innen war ein zentrales Merkmal der kulturellen Verwüstungen des sowjetischen Terrors. Zeitgleich mit dem Holocaust führten Stalinisierung, Terror und Gulag zur gezielten Zerstörung jüdischer Gemeinden von der Ukraine bis Wladiwostok. Um die bestehende Holocaust-Geschichtsschreibung zu erweitern untersucht dieses Projekt zwei klangliche Räume der Internierung: erstens im Rahmen einer Studie über evakuierte Menschen während des Zweiten Weltkriegs und ihre Interaktionen mit Klang während des Transports; zweitens im Rahmen einer Lokalstudie über Taschkent, die den jüdischen Transit nach Birobidzhan in der Vorkriegszeit und die Interaktionen der evakuierten Jüdinnen und Juden mit den bucharischen jüdischen Gemeinden in Zentralasien in Augenschein nimmt.
Alexandra Birch, international erfolgreiche Violinistin und Historikerin. Musikstudium (PhD) an der Arizona State University, Auftritte in über zwanzig Ländern. Derzeit Geschichtsstudium (PhD) an der UC Santa Barbara zum Zusammenhang von Musik und Massenverbrechen in der ehemaligen UdSSR.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Jenny Watson
Research Fellow (04/2024 – 08/2024)
Das Grauen in Worte fassen: Metaphern des Landlebens in Berichten über Massenerschießungen
 Das Projekt baut auf bestehenden Arbeiten zu landwirtschaftlichen Metaphern im Kontext von Massentötungen auf und erweitert deren Fokus durch die Einbeziehung historischer Quellen. Es analysiert Berichte aus erster Hand über Massenerschießungen, um herauszufinden, auf welche Weise Täter:innen, Überlebende und Zeug:innen Sprache aus den Bereichen des täglichen Lebens verwendeten, um die Gräueltaten zu artikulieren, die sie begangen, erlebt oder gesehen hatten. Die Hypothese – entwickelt aus der Arbeit mit literarischen Texten und inspiriert von Alon Confinos’ Arbeit über „unbewusstes narratives Enactment“ – lautet, dass Individuen die Motive und Prozesse des Massenmordes durch die Brille der Handlungsnormen gemeinschaftlicher Prozesse wie Jagen, Ernten und Schlachten betrachten.
Das Projekt baut auf bestehenden Arbeiten zu landwirtschaftlichen Metaphern im Kontext von Massentötungen auf und erweitert deren Fokus durch die Einbeziehung historischer Quellen. Es analysiert Berichte aus erster Hand über Massenerschießungen, um herauszufinden, auf welche Weise Täter:innen, Überlebende und Zeug:innen Sprache aus den Bereichen des täglichen Lebens verwendeten, um die Gräueltaten zu artikulieren, die sie begangen, erlebt oder gesehen hatten. Die Hypothese – entwickelt aus der Arbeit mit literarischen Texten und inspiriert von Alon Confinos’ Arbeit über „unbewusstes narratives Enactment“ – lautet, dass Individuen die Motive und Prozesse des Massenmordes durch die Brille der Handlungsnormen gemeinschaftlicher Prozesse wie Jagen, Ernten und Schlachten betrachten.
Jenny Watson, Chancellor’s Fellow an der University of Edinburgh, wo sie im Deutsch-Programm der School of Languages, Literatures and Cultures unterrichtet. Ihr Postdoc-Projekt „Restless Earth: Extra-Concentrationary Violence since 1945“ beschäftigte sich mit der Darstellung des sogenannten „Holocaust by Bullets“ in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Research Fellowships 2023/24 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Research Fellowships für das Studienjahr 2023/24 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzler-amt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Research Fellows können sich promovierte Forscher:innen bewerben, die bereits wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Rese-arch Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Die Research Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Eingereichte Projekte der Research Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Research Fellowships beträgt mindestens fünf bis elf Monate. Sie erhalten am VWI einen Arbeitsplatz und Internetzugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.200.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten (bis € 700.- im Monat) während des Aufenthalts sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl der Research Fellows erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Pro-jekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge),
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto, falls die entsprechenden Fel-der nicht schon im Antragsformular ausgefüllt worden sind (fakultativ).
Die Anträge sind bis 13. Jänner 2023 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusam-mengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2023/24“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu richten.
Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Research Fellowships 2024/25 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Rese-arch Fellowships für das Studienjahr 2024/25 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom öster-reichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzler-amt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Do-kumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich sei-ner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Research Fellows können sich promovierte Forscher:innen bewerben, die bereits wissen-schaftliche Publikationen vorgelegt haben. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Rese-arch Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Die Research Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Eingereichte Projekte der Research Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Frage-stellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse wer-den im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Research Fellowships beträgt mindestens fünf bis maximal elf Monate. Sie erhal-ten am VWI einen Arbeitsplatz und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.200.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten (bis € 600.- im Monat) während des Aufenthalts sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein ein-maliges Budget in der Höhe von weiteren € 200.- zur Verfügung.
Die Auswahl der Research Fellows erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Pro-jekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge),
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto, falls die entsprechenden Fel-der nicht schon im Antragsformular ausgefüllt worden sind (fakultativ).
Die Anträge sind bis 12. Jänner 2024 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusam-mengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2024/25“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! zu richten.
Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Gergely Kunt
Research Fellow (10/2022 – 03/2023)
„Bilder der Anderen“: Eine vergleichende Analyse anti-Roma und antisemitischer Narrative im privaten und öffentlichen Diskurs in Ungarn vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg
 Das Projekt konzentriert sich auf die Untersuchung verschiedener Diskursebenen, die zur Assoziation negativer sozialer Bilder und Stereotypen von Jüdinnen und Juden sowie Rom:nja in Ungarn führten. Anstatt sich auf den politischen Hintergrund des Völkermords oder die anti-Roma und antisemitischen Gesetze zu fokussieren, soll hier der „soziale und mentale Kontext“ erforscht werden – also die Verbreitung gegen Roma gerichteter und antisemitischer Bilder und die Verinnerlichung negativer Stereotypen durch die Mehrheitsgruppe. Solche Bilder waren eine wichtige Voraussetzung für den Völkermord während des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt: Die Forschung stützt sich in erster Linie auf die Sozialpsychologie und die Sprach- und Diskursanalyse von Zeitungsartikeln und Egodokumenten (vor allem Tagebüchern) aus dem Ungarn der Zwischenkriegszeit, wobei besonderes Augenmerk auf den Sprachgebrauch der Autor:innen gelegt wird. Das Projekt behandelt die Texte als Teil der zeitgenössischen sozialen Realität, die durch Sprache geschaffen wird.
Das Projekt konzentriert sich auf die Untersuchung verschiedener Diskursebenen, die zur Assoziation negativer sozialer Bilder und Stereotypen von Jüdinnen und Juden sowie Rom:nja in Ungarn führten. Anstatt sich auf den politischen Hintergrund des Völkermords oder die anti-Roma und antisemitischen Gesetze zu fokussieren, soll hier der „soziale und mentale Kontext“ erforscht werden – also die Verbreitung gegen Roma gerichteter und antisemitischer Bilder und die Verinnerlichung negativer Stereotypen durch die Mehrheitsgruppe. Solche Bilder waren eine wichtige Voraussetzung für den Völkermord während des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird ein interdisziplinärer Ansatz verfolgt: Die Forschung stützt sich in erster Linie auf die Sozialpsychologie und die Sprach- und Diskursanalyse von Zeitungsartikeln und Egodokumenten (vor allem Tagebüchern) aus dem Ungarn der Zwischenkriegszeit, wobei besonderes Augenmerk auf den Sprachgebrauch der Autor:innen gelegt wird. Das Projekt behandelt die Texte als Teil der zeitgenössischen sozialen Realität, die durch Sprache geschaffen wird.
Gergely Kunt, Sozialhistoriker und Assistenzprofessor an der Universität Miskolc (Ungarn). Gründungsmitglied des European Ego-Documents Archive and Collections Network (EDAC). Autor von The Children's Republic of Gaudiopolis: The History and Memory of a Children's Home for Holocaust and War Orphans (2022) und mehrerer Monographien auf Ungarisch. Er war Core Fellow am Institute for Advanced Study der Central European University und Weickert Postdoctoral Fellow am Fritz Bauer Institut der Universität Frankfurt am Main.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Anna G. Piotrowska
Research Fellow (01/2023 – 06/2023)
Roma Musiker:innen und der Holocaust
 Das Projekt soll den vergessenen Holocaust an den Rom:nja beleuchten, indem die Funktion der Musik und die Stellung der Roma-Musiker:innen in den Konzentrationslagern untersucht wird. Während der Ausgangspunkt des Projekts die Analyse der Mechanismen zur Stereotypisierung der europäischen „Anderen“ als Musiker:innen ist, rekonstruiert das Projekt vor allem die Position und Rezeption von Roma-Musiker:innen während des Holocaust, mit besonderem Augenmerk auf ihre Situation in den Konzentrationslagern. Das Projekt konzentriert sich auf Roma, aber auch auf jüdische Musiker:innen, die in Mitteleuropa besonders bekannt sind, etwa Geiger:innen und Zimbalist:innen, und untersucht deren unterschiedliche Musiktraditionen in der Öffentlichkeit. Dabei wird die Frage gestellt, ob und inwieweit ihre Rezeption in der europäischen Kultur das Schicksal von Roma- und jüdischen Musiker:innen in den Konzentrationslagern beeinflusst.
Das Projekt soll den vergessenen Holocaust an den Rom:nja beleuchten, indem die Funktion der Musik und die Stellung der Roma-Musiker:innen in den Konzentrationslagern untersucht wird. Während der Ausgangspunkt des Projekts die Analyse der Mechanismen zur Stereotypisierung der europäischen „Anderen“ als Musiker:innen ist, rekonstruiert das Projekt vor allem die Position und Rezeption von Roma-Musiker:innen während des Holocaust, mit besonderem Augenmerk auf ihre Situation in den Konzentrationslagern. Das Projekt konzentriert sich auf Roma, aber auch auf jüdische Musiker:innen, die in Mitteleuropa besonders bekannt sind, etwa Geiger:innen und Zimbalist:innen, und untersucht deren unterschiedliche Musiktraditionen in der Öffentlichkeit. Dabei wird die Frage gestellt, ob und inwieweit ihre Rezeption in der europäischen Kultur das Schicksal von Roma- und jüdischen Musiker:innen in den Konzentrationslagern beeinflusst.
Anna G. Piotrowska, Musikwissenschaftlerin (Jagiellonien-Universität in Krakau und Durham University), veröffentlichte zahlreiche Bücher und Artikel zur Rolle, die Musik bei der Gestaltung, Beeinflussung und Widerspiegelung kultureller und politischer Kontexte spielt. Sie befasst sich mit Fragen an der Schnittstelle von Musikkultur und den Konzepten von race und Ethnizität.
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Research Fellowships 2021/2022 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Research Fellowships für das Studienjahr 2021/2022 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte. Zudem ermuntern wir ForscherInnen aus dem Feld der Digital Humanities mit holocaustrelevanten Themen zur Bewerbung.
Als Research Fellows können sich promovierte Forscherinnen und Forscher bewerben, die bereits wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Research Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Die Research Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Eingereichte Projekte der Research Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikel vorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Research Fellowships beträgt mindestens sechs, maximal elf Monate. Erfahrungsgemäß sind Aufenthalte zwischen neun und elf Monaten für die wissenschaftliche Arbeit der Fellows am ergiebigsten. Sie erhalten am VWI einen Arbeitsplatz mit EDV- und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.200.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten (bis € 700.-) während des Aufenthalts sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl der Research Fellows erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge),
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto, falls die entsprechenden Felder nicht schon im Antragsformular ausgefüllt worden sind (fakultativ).
Die Anträge sind bis 27. Jänner 2021 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2020/2021“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
zu richten. Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Die zukünftigen Research Fellows werden angehalten, zu versuchen, einen Teil ihrer Fellowships über ein Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich zu finanzieren, und nach der Benachrichtigung über die Zuerkennung des Fellowships einen diesbezüglichen Antrag zu stellen.
Research Fellowships 2022/2023 des Wiener Wiesenthal Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Research Fellowships für das Studienjahr 2022/2023 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundeskanzleramt sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Research Fellows können sich promovierte Forscherinnen und Forscher bewerben, die bereits wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, einem selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissenschaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Research Fellows die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorhaben beratend unterstützen. Die ResearchFellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu sein.
Eingereichte Projekte der Research Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des institutseigenen Archivs stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum präsentiert. Am Ende des Aufenthalts ist ein Artikelvorzulegen, der begutachtet und im E-Journal des VWI, S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. veröffentlicht wird.
Die Dauer der Research Fellowships beträgt mindestens fünf bis elf Monate. Sie erhalten am VWI einen Arbeitsplatz und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt € 2.200.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten (bis € 700.-) während des Aufenthalts sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Recherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten außer Haus steht ein einmaliges Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl der Research Fellows erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
- einem ausgefüllten Antragsformular,
- einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge),
- einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto, falls die entsprechenden Felder nicht schon im Antragsformular ausgefüllt worden sind (fakultativ).
Die Anträge sind bis 14. Jänner 2022 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff „VWI-Research Fellowships 2019/2020“ an
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
zu richten. Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren.
Rita Horváth
Research Fellow (10/2017–05/2018)
Wut und Erinnerung verhandeln. (Wieder)ErlebteErfahrungen ungarisch-jüdischer Kinderzwangsarbeiter in Wien und Umgebung 1944–1945 in Memoiren und Zeugnissen
 Die Erfahrungen ungarisch-jüdischer Kinder, die 1944/1945 nach Wien und Umgebung zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, stehen im Mittelpunkt des Projektes – vor allem interessiert die Frage, wie sich diese später in ihren literarischen Erinnerungen und Zeugnissen niederschlagen. Eine Besonderheit dieses Kapitels des Holocaust besteht darin, dass die Mehrheit der Zeugenberichte von Deportierten stammt, die zu dieser Zeit Kinder waren, und damit gerade die Erinnerungen von Kindern eine wichtige Quelle für die Erforschung der Zwangsarbeit in Wien darstellen. Aufgezeigt wird nicht nur der Stellenwert dieser Dokumente, sondern auch, welche Fülle von entscheidenden Informationen aus diesen Zeugnissen der überlebenden Kinder gewonnen werden kann.
Die Erfahrungen ungarisch-jüdischer Kinder, die 1944/1945 nach Wien und Umgebung zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, stehen im Mittelpunkt des Projektes – vor allem interessiert die Frage, wie sich diese später in ihren literarischen Erinnerungen und Zeugnissen niederschlagen. Eine Besonderheit dieses Kapitels des Holocaust besteht darin, dass die Mehrheit der Zeugenberichte von Deportierten stammt, die zu dieser Zeit Kinder waren, und damit gerade die Erinnerungen von Kindern eine wichtige Quelle für die Erforschung der Zwangsarbeit in Wien darstellen. Aufgezeigt wird nicht nur der Stellenwert dieser Dokumente, sondern auch, welche Fülle von entscheidenden Informationen aus diesen Zeugnissen der überlebenden Kinder gewonnen werden kann.
Zur Beschreibung und Erörterung dieser Texte kommen literaturwissenschaftliche und historische Methoden zur Anwendung. Zudem werden diese Texte mit anderen, im Rahmen großer Oral-History-Projekte gesammelten nichtliterarischen Zeugnissen von Kindern verglichen: Ziel ist es, die zentralen Themen sowie deren Stellenwert in der Gesamterzählung zu identifizieren und jene Emotionen festzumachen, die die Zeugnisse der überlebenden Kinder ungarisch-jüdischer Zwangsarbeit in Wien bestimmen.
Rita Horváth, Literaturwissenschaftlerin und Historikerin, promovierte 2003 an der Bar-Ilan Universität (Ramat Gan, Israel). Seit 2010 ist sie Research Associate an der Brandeis University (Waltham, MA, USA) und Research Fellow des International Institute for Holocaust Research in Yad Vashem. Seit 2004 ist sie Lektorin im Rahmen des Programms für Holocaust-Studien der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, zwischen 2005 und 2012 lehrte sie englische sowie Holocaust-Literatur an der Bar-Ilan Universität. Ihre Forschungsschwerpunkte sind der Holocaust in Ungarn, Holocaust-Literatur, Traumaforschung und Literaturtheorie.
Michal Frankl
Research Fellow (10/2018–03/2019)
BürgerInnen des Niemandslandes. Jüdische Flüchtlinge und die Aushöhlung des Bürgerrechts in Ostmitteleuropa, 1935–1938
 Über das ganze Jahr 1938 hinaus entstanden entlang der ostmitteleuropäischen Staatsgrenzen ganz eigentümliche, neue Territorien, quasi Niemandsländer für Flüchtlinge. Kleine oder auch größere Menschengruppen wurden gezwungen, an Straßen, auf Äckern, in baufälligen Gebäuden, zwischen Grenzposten oder hinter Grenzen interniert zu kampieren. Von einer Erkundung dieser Niemandsländer ausgehend, wird die Entwicklung einer restriktiven Flüchtlingspolitik in Ostmitteleuropa untersucht und dabei die Verschiebungen und Verwerfungen hin zu einem mehr und mehr ethnisch definierten (Staats)Bürgerverständnis ab der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre analysiert.
Über das ganze Jahr 1938 hinaus entstanden entlang der ostmitteleuropäischen Staatsgrenzen ganz eigentümliche, neue Territorien, quasi Niemandsländer für Flüchtlinge. Kleine oder auch größere Menschengruppen wurden gezwungen, an Straßen, auf Äckern, in baufälligen Gebäuden, zwischen Grenzposten oder hinter Grenzen interniert zu kampieren. Von einer Erkundung dieser Niemandsländer ausgehend, wird die Entwicklung einer restriktiven Flüchtlingspolitik in Ostmitteleuropa untersucht und dabei die Verschiebungen und Verwerfungen hin zu einem mehr und mehr ethnisch definierten (Staats)Bürgerverständnis ab der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre analysiert.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Vorgeschichte, der Umsetzung und den Folgen auf die im großen Maßstab erfolgten Ausweisungen von Juden, die zu Grenzschließungen und härteren ordnungspolitischen Maßnahmen gegenüber jüdischen Flüchtlingen und zur Ausbürgerung von Juden führten. Im Vordergrund steht dabei ein besseres Verständnis des Zusammenspiels zwischen der Marginalisierung von ausgebürgerten Juden und jüdischen Flüchtlingen sowie die schrittweise Aushöhlung der Staatsbürgerschaft sowie der Bürgerrechte der verbliebenen jüdischen Gemeinwesen.
Michal Frankl ist Senior Researcher am Masaryk Institut und Archiv der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und leitet ein Work Package im Rahmen des EU-Projekts European Holocaust Research Infrastructure. Er zeichnet für mehrere Veröffentlichungen zur Geschichte des Antisemitismus, der Flüchtlingspolitiken und des Holocaust in den Ländern Tschechiens sowie Ostmitteleuropa.
Diana Dumitru
Research Fellow (02/2019–07/2019)
Vom Freund zum Feind? Der Sowjetstaat und seine Juden nach dem Holocaust
 Vorrangiges Ziel des Projekts ist die Klärung dessen, wie die Sowjetgesellschaft sich den Folgen des Holocausts stellte. Wie gestaltete sich die Wechselbeziehung zwischen folgenden drei Dynamiken:
Vorrangiges Ziel des Projekts ist die Klärung dessen, wie die Sowjetgesellschaft sich den Folgen des Holocausts stellte. Wie gestaltete sich die Wechselbeziehung zwischen folgenden drei Dynamiken:
(i) Begegnungen von Juden und Nichtjuden,
(ii) den diesbezüglichen Strategien und Taktiken des Sowjetstaates und
(iii) den unterschiedlichen Pfaden, die sowohl von sowjetischen Jüdinnen und Juden, Nichtjuden sowie staatlicherseits eingeschlagen wurden, wenn es darum ging, die Implikationen des Holocaust zu erfassen und einen neuen, in der Zukunft zu beschreitenden Weg für die sowjetische Gesellschaft zu finden.
Konkret wird gefragt, inwieweit vom sowjetischen Staat und seinen Eliten im Spätstalinismus eine antisemitische Agenda betrieben wurde – und was die offenen und/oder versteckten Kanäle waren, diese Agenda an die Mittelspersonen der unteren Ebenen weiterzugeben, damit diese das Programm umsetzen können. Mit diesem Ansatz werden aber gleichzeitig auch die Implikationen der stalinistischen Politik gegenüber anderen ‚Nationalitäten’ der Sowjetunion angesprochen.
Diana Dumitru ist Dozentin für Geschichte an der staatlichen Universität Ion Creangă in Moldawien. Sie ist Verfasserin von mehr als dreißig wissenschaftlichen Artikeln und zwei Büchern: The State, Antisemitism and the Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of Romania and the Soviet Union wurde 2016 bei Cambridge University Press veröffentlicht. Sie ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des EU-Projekts European Holocaust Research Infrastructure.